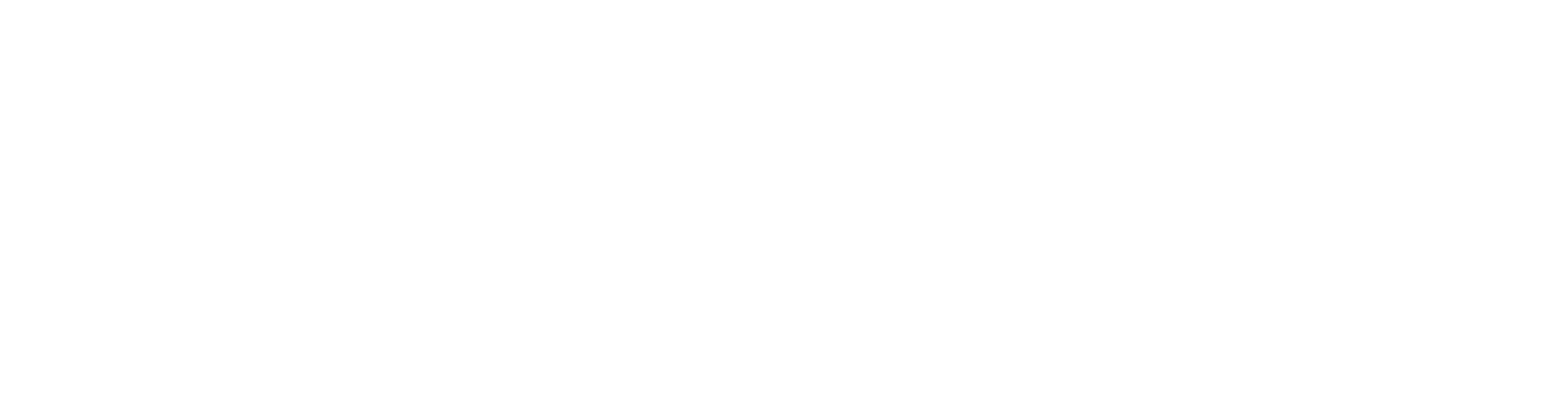Strukturierte Hitzeaktionspläne nach VDI-EE 3787
Die Hitzerekorde in Deutschland überschlagen sich seit Jahren: 2003 der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, 2018 der Rekord an Hitzetagen über 30 Grad im Jahr, 2019 die höchste jemals in Deutschland gemessene Tagestemperatur mit 41,2 Grad Celsius. Diese Parade der meteorologischen Superlative ist jedoch nicht nur auf Entertainment-Ebene interessant und aus klimatischer Perspektive höchst bedenklich, sondern zieht auch ganz konkrete Folgen für die Menschen nach sich.

Hitze: Klima-Todesursache Nummer eins in Deutschland
In Deutschland sterben mehr Menschen durch Hitze als durch Stürme, Kälte und Blitze zusammen. Und das nicht nur im Rekordsommer 2003, der europaweit zu 70.000 hitzebedingten Todesfällen führte, sondern Jahr für Jahr: Zwischen 3.000 und 9.000 Hitzetoten zählt Deutschland jährlich – und ein Ende ist nicht in Sicht. Gegensteuern kann man nur mittels koordiniertem und systematischem Hitzeschutz. Doch der ist hierzulande noch eine Art Flickenteppich aus uneinheitlichen kommunalen Vorgaben.
Bereits 2008 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Leitfaden für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen. In Deutschland geschah dann eine Weile nichts, bis 2017 eine Arbeitsgruppe Handlungsempfehlungen herausgab, die als Grundlage für die Hitzeaktionsplanung in Kommunen und Ländern dienen sollten. Das Ergebnis ist, laut einer bundesweiten Studie von 2023, der besagte Flickenteppich aus Aktionsplänen.
Normative Handlungsgrundlage für systematischen Hitzeschutz
Die VDI-Expertenempfehlung 3787 Blatt 13.1 räumt damit auf. Sie bietet in drei Blättern endlich das normative Fundament für deutschlandweit strukturierte Hitzeaktionspläne. Die drei Blätter orientieren sich an den Handlungsempfehlungen von 2017 und versammeln Informationen, Konkretisierungen und Anforderungen für acht Kernelemente, von denen wir hier die vier Kernelemente vorstellen wollen, die sich in Blatt 13.1 der Reihe finden.
Kernelement I: Zentrale Koordinierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit
Der Bevölkerungsschutz vor Hitzeereignissen ist keine Aufgabe für eine Stelle allein. Tatsächlich müssen viele Organe zusammenwirken, um die komplexen Herausforderungen von Hitzeaktionsplänen zu bewältigen. Eine zentrale Koordinierungsstelle innerhalb von Kommunen ermöglicht das orchestrierte Ansteuern von verschiedenen Beteiligten wie Bezirksregierungen, Ärztekammer, Landesumweltamt, Hilfsorganisationen oder Medien.
Wie es funktionieren kann, sieht man am Beispiel der Stadt Mannheim: Installiert wurden hier drei zentrale Gremien, das „Koordinierungskomitee Hitze“, der HAP-Steuerungskreis und die Beauftragten für vulnerable Personengruppen. Die städtischen Fachbereiche wie Gesundheitsamt, Umweltamt und Katastrophenschutz arbeiten eng zusammen mit externen Partnern wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Zudem wurden Projekte mittels Bürgerbeteiligung und Workshops realisiert, darunter eine interaktive Karte der kühlen Orte in Mannheim.
Kernelement II: Nutzung des Hitzewarnsystems
Die Zeiten, in denen wir von Hitzewellen vollständig überrascht werden, sind dank fortgeschrittener Meteorologie vorbei: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) errechnet aus einer Kombination von Lufttemperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Strahlungseinflüssen die tägliche Hitzewarnstufe, und mittels Modellrechnungen sogar Trends bis zu 48 Stunden im Voraus. So bleibt den Kommunen genug Zeit für Maßnahmen, darunter das Informieren der Bevölkerung. Viele Nutzer – rund fünf Millionen – lassen sich bereits direkt vom DWD über bevorstehende extreme Wetterereignisse informieren (z. B. WarnWetter-App). Eingeteilt wird die Gefahrenlage dabei in zwei Stufen: Starke Wärmebelastung (Stufe I) und extreme Wärmebelastung (Stufe 2). Die VDI-Expertenempfehlung 3787 Blatt 13.1 leitet gestaffelte Maßnahmen ab und sorgt so für einheitliche Reaktionen der Kommunen.
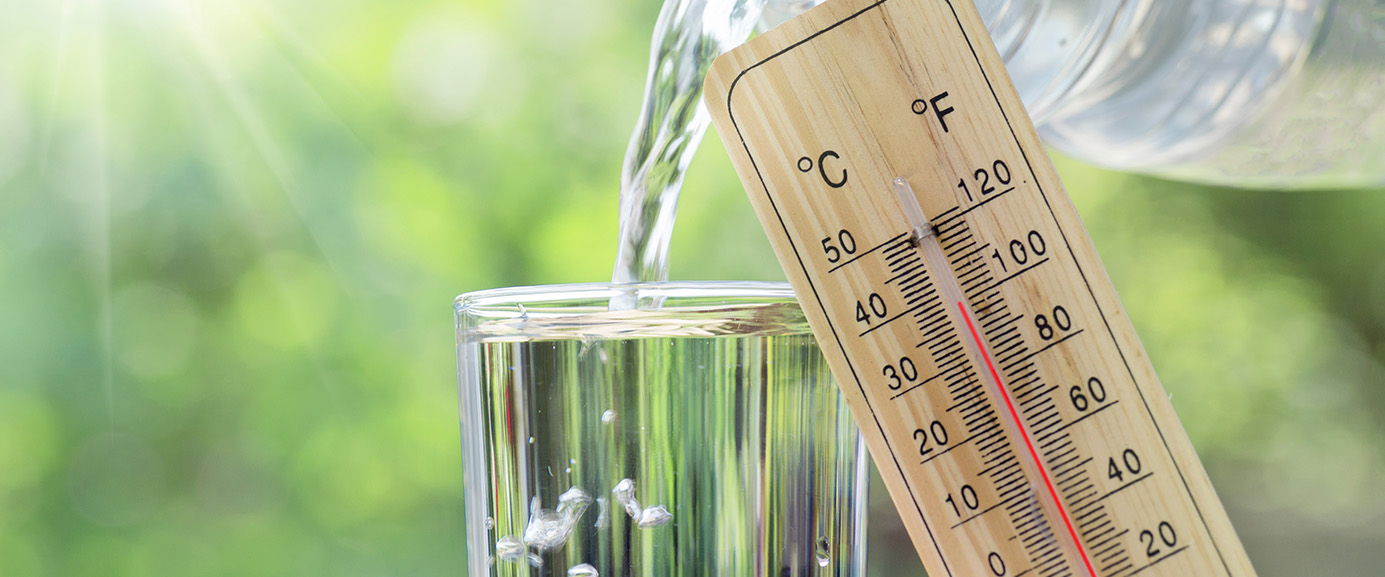
Kernelement III: Information und Kommunikation
Nur wenn die Betroffenen von einem bevorstehenden Hitzeereignis wissen, können sie sich selbst schützen. Information und Kommunikation sind daher ein bedeutsames Kernelement von Hitzeaktionsplänen. Dazu gehört nicht nur die Warnung im Gefahrenfall, sondern auch die vorherige Herausgabe von Handlungsempfehlungen und die direkte Ansprache von vulnerablen Personenkreisen.
Moderne Medien, insbesondere Apps, kommen bei der Information und Kommunikation von Hitzeereignissen immer stärker zum Einsatz. Neben der genannten WarnWetter-App des DWD gibt es auch dessen Gesundheitswetter-App und die Warn-App NINA, die bereits von zwölf Millionen Menschen genutzt wird. Auf kommunaler Ebene hat die Stadt Hamburg mit ihrer Kampagne „Werde wetterwach!“ Vorbildcharakter bewiesen: Neben analogen und digitalen Ansprachen auf verschiedenen Kanälen bietet sie auch Förderprogramme für bauliche Maßnahmen zur Anpassung an Extremwetter.
Kernelement IV: Monitoring und Evaluierung
Waren die getroffenen Maßnahmen erfolgreich? Konnte die Zahl der Hitzegeschädigten gesenkt werden? Müssen Maßnahmen ersetzt, gestrichen, hinzugefügt, anpasst werden? Monitoring und Evaluierung helfen, Hitzeaktionspläne an der Wirklichkeit auszurichten. Auch wenn Daten nicht für alle Regionen und Bereiche verfügbar sind, lassen sich viele Effekte von Hitzeschutzmaßnahmen bereits messen. Das fängt bei der subjektiven Befindlichkeitsverbesserung in der Bevölkerung und geht bis zur Übersterblichkeit im Verlauf von Hitzewellen.
Auch für Monitoring und Evaluierung ist die direkte Rückkopplung mit Betroffenen und involvierten Personenkreisen wertvoll. Hier greifen das Kernelement IV und das Kernelement I – zentrale Koordinierung und interdisziplinäre Zusammenarbeit – der Hitzeaktionsplanung ineinander.
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Extremwetterereignisse – auch Hitzewellen – ein bleibender und immer größerer Teil unseres Alltags sein werden. Wir können diesen Herausforderungen begegnen, indem wir gemeinsam und strukturiert vorgehen. Hitzeaktionsschutzpläne dürfen kein wilder Flickenteppich über der Bundesrepublik bleiben, sondern brauchen durchdachte Normen.
Wir stehen vor einer klimatischen Anpassungsaufgabe. Die VDI-Expertenempfehlung 3787 Blatt 13.1 bietet, gemeinsam mit den anderen beiden Blättern der Reihe, die Arbeitshilfen zur praktischen Umsetzung von Hitzeaktionsplänen, die Kommunen und Länder nun brauchen. Mit hochwertigen, praxisorientierten Standards und der Einbeziehung von öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen und der Bevölkerung kann die Aufgabe gelingen, die zu den zentralen Themen dieses Zeitalters gehört. Klimaanpassung ist keine Option mehr, sondern Pflicht – und die VDI-EE 3787 Blatt 13.1 der Werkzeugkasten dazu.
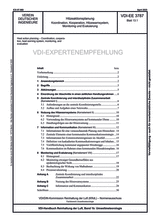
Technische Regel [NEU] 2025-04
VDI-EE 3787 Blatt 13.1:2025-04ab 101,00 EUR inkl. MwSt.
ab 94,39 EUR exkl. MwSt.
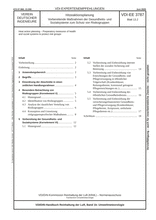
Technische Regel [NEU] 2025-06
VDI-EE 3787 Blatt 13.2:2025-06ab 79,10 EUR inkl. MwSt.
ab 73,93 EUR exkl. MwSt.
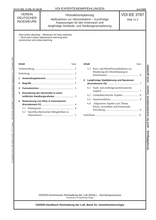
Technische Regel [NEU] 2025-06
VDI-EE 3787 Blatt 13.3:2025-06ab 69,60 EUR inkl. MwSt.
ab 65,05 EUR exkl. MwSt.